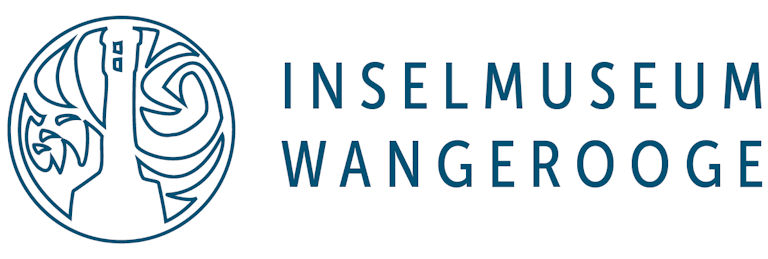Im Jahre 1327 wird die Insel unter dem Namen „Wangeroch“ erstmals urkundlich erwähnt. Der Wortteil „Wanga“ stammt aus dem Altgermanischen und bedeutet Wiese oder Ebene. Die Silbe „och“ wurde später zu „oog“ bzw. „ooge“ und verweist auf das friesische Wort Og für Insel.
Wie die anderen sechs ostfriesischen Inseln hat sich auch Wangerooge aus einer Sandbank entwickelt. Das Meer und der Wind sorgen für eine ständige Bewegung des Sandes, im Westen wird er abgetragen und im Osten wieder angelandet. So „wanderte“ die Insel mit der Hauptströmungsrichtung langsam immer weiter nach Osten.
Zwischen 1650 und 1850 verlagerte sich der Westteil der Insel um etwa 800 Meter in östliche Richtung. Wiederholt mussten die Menschen auf der Insel ihre Siedlung nach Osten verlegen, so z. B. als in der Silvesternacht 1854 das Dorf um den alten Westturm herum einer verheerenden Sturmflut zum Opfer fiel.
Über die Silvester- bzw. Neujahrsflut von 1854/55 berichtet rund 40 Jahre später der ehemalige Seemann Christian Christians auf Wangerooge. Er war Sohn eines Schiffers und wurde 1819 auf der Insel geboren. Als 1897 der Tübinger Professor für Sprachen Enno Littmann als Badegast im Hause Christians auf der Insel weilte, war dieser besonders an der friesischen Sprache interessiert, die Christian Christians noch beherrschte. Um 1900 fand das Badeleben bereits im Osten der Insel statt, wo sich um den 1856 erbauten Leuchtturm das neue Dorf nach der schweren Sturmflut in der Neujahrsnacht 1855 gegründet hatte.
Die Flut zerstörte das bereits während der Februarflut 1825 stark beeinträchtige Dorf im Westen rund um den alten 1597 errichteten großen Turm, der neben seiner Funktion als Seezeichen auch einen Kirchenraum hatte. 1830 war hier als Ersatz für die alte Kohlenblüse von Otto Lasius im Auftrag der großherzoglichen Regierung ein moderner Leuchtturm errichtet worden. Dieser wurde, wie viele Häuser in dem Westdorf, wo auch bereits umfangreiche Anlagen für das Badeleben errichtet waren, durch Wind und Wellen zerstört.
Das war im Jahre 1854, und da hatten wir einen ganz schlimmen Herbst, lauter Sturmwetter, und das ganz schlimm. Das Wasser kam nicht von den Dünen ab; das konnte nicht zum Fallen kommen, wegen des steifen Windes. Der Wind war immer Westsüdwest, und das wurde immer schlimmer, und das hielt acht Tage vor Weihnachten an und wurde immer schlimmer. Weihnachten waren wir schon dabei, Häuser abzubrechen. Denn wir sahen das wohl, wenn der Wind dorthin aufraumte und westlicher lief, nach Nordwesten hinein, dann wird es ganz schlimm. Und das tat er zwischen Weihnachten und Neujahr, und Tag für Tag wurde es schlimmer, bis Neujahrsnacht war es ganz schlimm. Da gingen etwa 13, 14 Häuser an den Dünen herunter. All den Hausrat, der darin war, den hatten wir dort schon herausgetragen, und zwar in Häuser, die noch sicher standen. Die waren bis unter die Dachböden voll, und das Meiste war in unserem Hause – der, der dies hier erzählt, der hat das alles mitgemacht. Der ist noch in dem letzten Hause gewesen, um es abzubrechen und die Möbel herauszuholen, bis dass die Seen schon gegen die Mauern anschlugen. Das Haus, das fing schon an zu krachen, zu den Türen konnten wir nicht mehr hinauskommen: die Seen schlugen schon gegen die Türen an. Da mussten wir zum Fenster hinaus. Wir waren noch keine 15 Schritte vom Hause, da fiel das ganze Haus von der Seite herunter; von ihm war keine Spur mehr zu sehen. Da gingen wir und schauten nach, da war unser ganzer Kirchhof weg. Die Toten lagen in unseren Gärten, heil und auch stückweise. Heile Särge haben wir auch noch gefunden, und die Hälften und die Stücke haben wir beieinander gesucht und haben wir in den Ostdünen wieder begraben, wo unser Kirchhof jetzt ist. Da kam die Regierung (aus Oldenburg) hier nach Wangerooge und wollte uns alle von dannen haben und hielt uns vor, wir sollten Vorschuss haben, um nach dem Festland überzusiedeln. wir konnten uns eine Stätte wählen, wo wir hin wollten, und sollten Vorschuss haben 400, 500 und auch 600 Reichstaler und sie wollten uns am liebsten nach Varel haben, dieweil er (der Großherzog) dort Land zu bebauen hatte (die heutige Neuwangerooger Straße am Vareler Hafen). Dorthin mögen auch wohl 15 Familien übergesiedelt sein und die Grundstücke, die ihnen angewiesen wurden, haben sie 10 Jahre frei, ohne davon etwas abzubezahlen. Dann fingen die Zinsen an und die sich nicht helfen konnten und die auch keinen Vorschuss kriegen konnten, denen wurde ein Haus angewiesen, in Varel, das hieß Braugarten. Die geringen Leute kamen darin frei zu wohnen, und dann kriegten sie á Person 40 Reichstaler Unterstützungsgeld. Da kam die Regierung wieder und wollte uns auch von hier von dannen haben. Und das wollten wir nicht. Wir wollten hier auf Wangerooge bleiben. Da sagt die Regierung, wenn wir hier bleiben wollten, dann müssten wir uns selbst helfen. Wir hätten keine Hoffnung auf Unterstützung hier auf Wangerooge nicht. Und war da ein Mann in Jever – ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat – der war hier nach Wangerooge gekommen und hatte uns schon gefragt, ob wir hier am liebsten bleiben wollten. Da ist der Mann weggegangen nach Oldenburg und hat den Großherzog gefragt, ob er wohl eine Bittschrift für die, die auf Wangerooge bleiben wollten, genehmigen wollte. Und das hat er getan. Da hat der Mann so viel Geld zusammengekriegt, dass jeder 100 Reichstaler kriegte, sodass sie hier wieder im Ost-Ende ihre Häuser aufrichten konnten und 12 richtige Wangerooger Häuser sind hier wieder aufgebaut worden.“ Bericht des Insulaners Christian Christians über die schwere Sturmflut in der Neujahrsnacht 1854/55. (übersetzt aus dem Wangerooger Friesisch von Enno Littmann, Friesische Erzählungen aus Alt-Wangerooge, Oldenburg 1922, S. 11-15)
Heute ist der Westen der Insel weitgehend durch Küstenschutzbauten wie z. B. Schutzmauern oder Buhnen befestigt und gesichert. Dennoch haben die Insulaner auch weiterhin mit dem Einfluss von Wasser und Wind zu kämpfen. So brachte der Orkan vom 16. auf den 17. Februar 1962 eine Verlagerung großer Sandmassen mit sich. Die unbefestigten Dünenlandschaft zwischen dem Nordwesten der Insel und dem Dorf einen Verlust von etwa 300.000 m³ Sandmasse. Nach einer Überschlagsrechnung wurdenungefähr 250.000 m³ auf einer östlichen Sandplatte aufgetragen (lt. Ludwig Hempel, 1994). Dies zeigt deutlich, dass sich im Osten die natürliche Dynamik erhalten hat. Dort ist die Entwicklung vom Strand bis zu Dünenstadien verschiedenen Alters gut zu beobachten.
In jedem Winter lassen die Sturmfluten in den letzten Jahren am Badestrand erhebliche Abbrüche zurück. Mit großem Aufwand muss der Sand wieder aufgeschüttet werden. Die Auswirkungen des Klimawandels sind hier schon deutlich spürbar; der Anstieg des Meeresspiegels und stärkere Stürme werden die Insel weiter verändern.